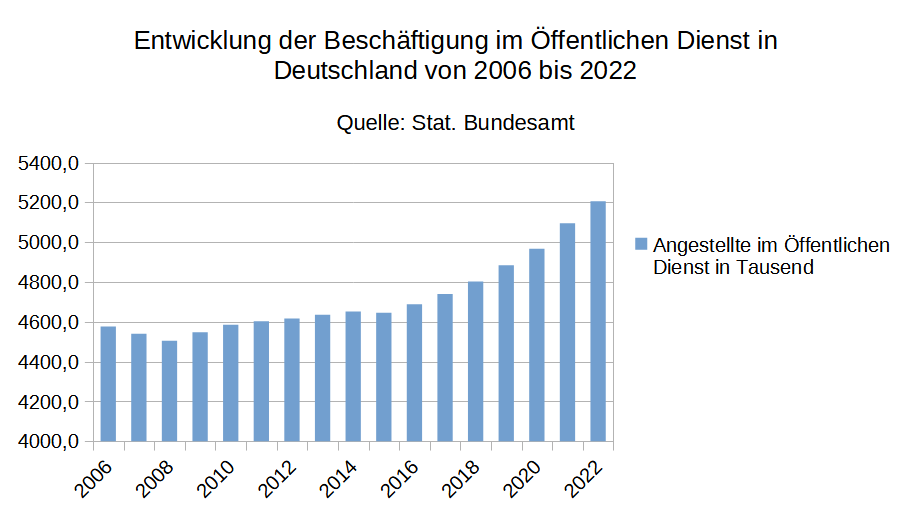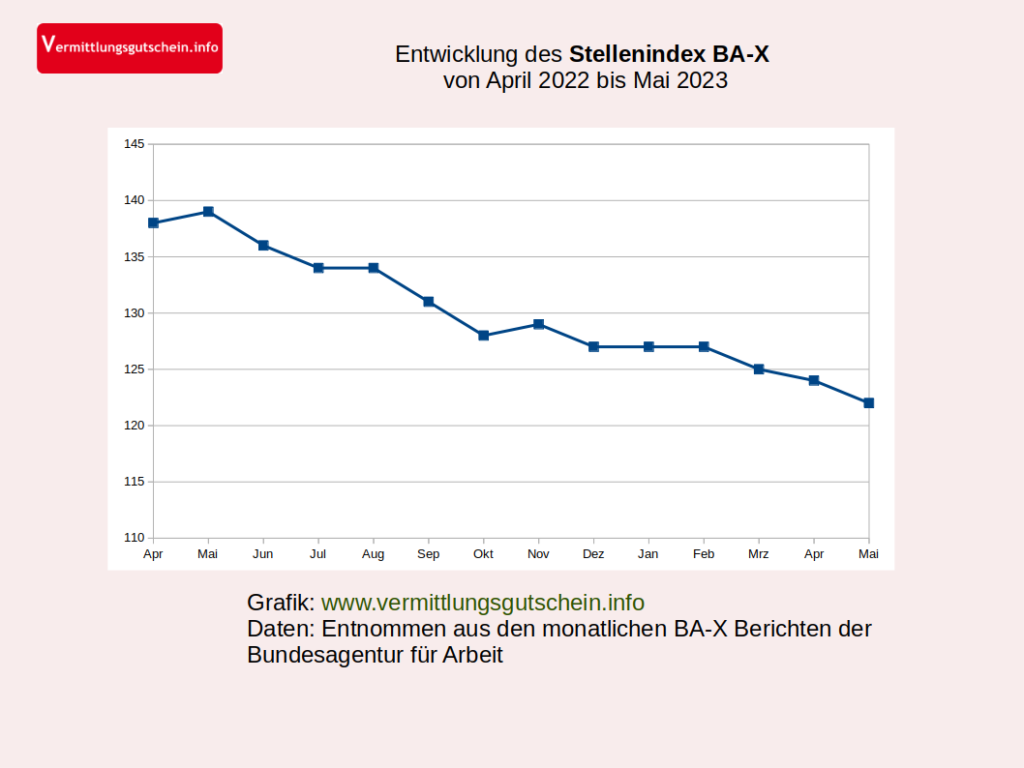Eine Zusammenfassung des aktuellen „Zuwanderungsmonitors“ des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Wer sich die Zahlen ansieht, erkennt: Es läuft nicht rund mit der Integration in den Arbeitsmarkt.
Die ausländische Bevölkerung in Deutschland ist nach Angaben des Ausländerzentralregisters im März 2023 gegenüber Februar 2023 um rund 37.000 Personen gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die ausländische Bevölkerung um 9,4 Prozent gewachsen. Dies liegt vor allem am starken Anstieg der Zahl von Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.
Die Zahl von Personen aus der EU-27 (also allen EU-Mitgliedsstaten) ist im Vorjahresvergleich um 1,8 Prozent gestiegen, von Personen aus den Asylherkunftsländern sogar um 7,4 Prozent. unter Asylherkunftsländer bezeichnet das IBA Personen mit einer Staatsangehörigkeit der zugangsstärksten Herkunftsländer von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien – damit sind also nicht alle Bewerber umfasst.
Mehr als die Hälfte der Zuzüge aus der Ukraine
Im laufenden Berichtsjahr 2023 sind nach Angaben des Ausländerzentralregisters von Januar bis März rund 325.000 Personen zugezogen. Mit rund 24 Prozent entfällt einer der höchsten Anteile auf Personen mit einer ukrainischen Staatsangehörigkeit. Rund 30 Prozent fallen auf Personen mit einer Staatsangehörigkeit der EU-27. Zum Vergleich: Im Februar 2022 lag der Anteil an Personen mit einer ukrainischen Staatsangehörigkeit an den Zuzügen bei etwa 2 Prozent. Bei den Fortzügen entspricht der Anteil der EU-27-Staatsangehörigen 23 Prozent und ist damit niedriger als im Vorjahreszeitraum (67 %). Bei Personen aus den Asylherkunftsländern entspricht der Anteil an der Zuwanderung 14 Prozent im Vergleich zu 7 Prozent im Vorjahreszeitraum – also eine Veroppelung. An der Abwanderung beträgt deren Anteil 5 Prozent und entspricht in etwa dem des Vorjahreszeitraums.
Beschäftigungszuwachs im Vergleich zum Vorjahresmonat
Die Beschäftigung der ausländischen Staatsangehörigen ist im Februar 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 460.000 Personen (+8,6 %) gestiegen. Unter den Personen mit einer EU-Staatsangehörigkeit stieg die Beschäftigung im gleichen Zeitraum um rund 115.000 (+4,4 %), unter den Staatsangehörigen aus den Asylherkunftsländern um 64.000 Personen (+11,9 %).
Die Beschäftigung von Staatsangehörigen aus den Asylherkunftsländern steigt damit stärker als bei anderen Staatsangehörigkeitsgruppen. Die Beschäftigung von Personen aus der Ukraine ist im Februar 2023 – im elften Monat seit Beginn des Krieges – im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 99.000 Personen (+150,8 %) gestiegen. Beschäftigungsquote gesunken
Im Februar 2023 betrug die Beschäftigungsquote der ausländischen Bevölkerung in Deutschland 52,6 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,7 Prozentpunkte gesunken. Für die Bevölkerung aus den EU-27-Ländern ist die Beschäftigungsquote um 1,6 Prozentpunkte auf 61,5 Prozent gestiegen.
Die Beschäftigungsquote von Personen aus den Asylherkunftsländern ist im Februar 2023 um 0,5 Prozentpunkte auf 41,0 Prozent gewachsen. Durch den starken Anstieg der ukrainischen Bevölkerung in Deutschland ist deren Beschäftigungsquote im Februar 2023 auf rund 20,4 Prozent gesunken. Im Januar 2022, kurz vor Ausbruch des Krieges, lag diese bei 52,1 Prozent.
Arbeitslosenzahlen der ausländischen Bevölkerung gestiegen
Die absolute Zahl der Arbeitslosen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist im April 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 249.000 Personen gestiegen (+35,2 %). Dabei ist die Zahl der Arbeitslosen mit einer Staatsangehörigkeit aus den EU-27-Ländern um rund 9.500 Personen gestiegen (+4,8 %). Für Personen aus den Asylherkunftsländern ist die Zahl der Arbeitslosen um rund 34.000 Personen (+14,8 %) gestiegen.
Bei ukrainischen Staatsangehörigen ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 185.000 Personen gestiegen. Der wesentliche Grund dafür dürfte der Wechsel ukrainischer Geflüchteter vom Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) am 1. Juni 2022 und die damit verbundene statistische Erfassung in der Grundsicherung sein. So werden hilfebedürftige Personen als arbeitslos erfasst, sofern sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Arbeitslosenquote der ausländischen Bevölkerung leicht gestiegen
Die Arbeitslosenquote der ausländischen Bevölkerung lag im Februar 2023 bei 14,9 Prozent und ist somit gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozentpunkte gestiegen. Unter den Staatsangehörigen aus der EU-27 betrug die Arbeitslosenquote im Februar 2023 8,1 Prozent (-0,2 %-Punkte). Unter den Staatsangehörigen aus den Asylherkunftsländern ist sie im selben Zeitraum um 0,6 Prozentpunkte auf rund 30,0 Prozent gesunken. Für ukrainische Staatsangehörige ist die Arbeitslosenquote im Februar 2023 auf 54,1 Prozent (+42,6 %-Punkte) gesunken.
Wie bei den Arbeitslosenzahlen dürfte der Wechsel ukrainischer Geflüchteten vom Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) am 1. Juni 2022 auch der wesentliche Grund für diesen Anstieg der Arbeitslosenquote sein. Zahl der SGB-II-Leistungsbeziehenden gestiegen Die absolute Zahl der ausländischen SGB-II-Leistungsbeziehenden ist im Januar 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 648.000 Personen gestiegen (+33,8 %).
Bei Personen mit einer Staatsangehörigkeit der EU-27-Länder gab es einen Rückgang von 13.000 Personen (-3,1 %). Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der SGB-II-Leistungsbeziehenden aus den Asylherkunftsländern um 450 Personen (+0,1 %) gestiegen. Die SGB-II-Hilfequote steigt im Vergleich zum Vorjahresmonat Die SGB-II-Hilfequote der ausländischen Bevölkerung lag im Januar 2023 bei 21,0 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozentpunkte gestiegen. Für die Bevölkerung aus den EU-27-Ländern lag die SGB-II-Hilfequote bei 8,9 Prozent (-0,4 %-Punkte), für die Bevölkerung aus den Asylherkunftsländern bei 45,0 Prozent (-3,9 %-Punkte).
Fazit: Auch ohne Ukraine-Effekt keine guten Zahlen
Selbst wenn man die Auswirkungen des Ukrainekriegs und die damit verbundene Migration von zumeist nicht erwerbsfähigen Personen ausklammert, fällt die Migrationsbilanz sehr schlecht aus.